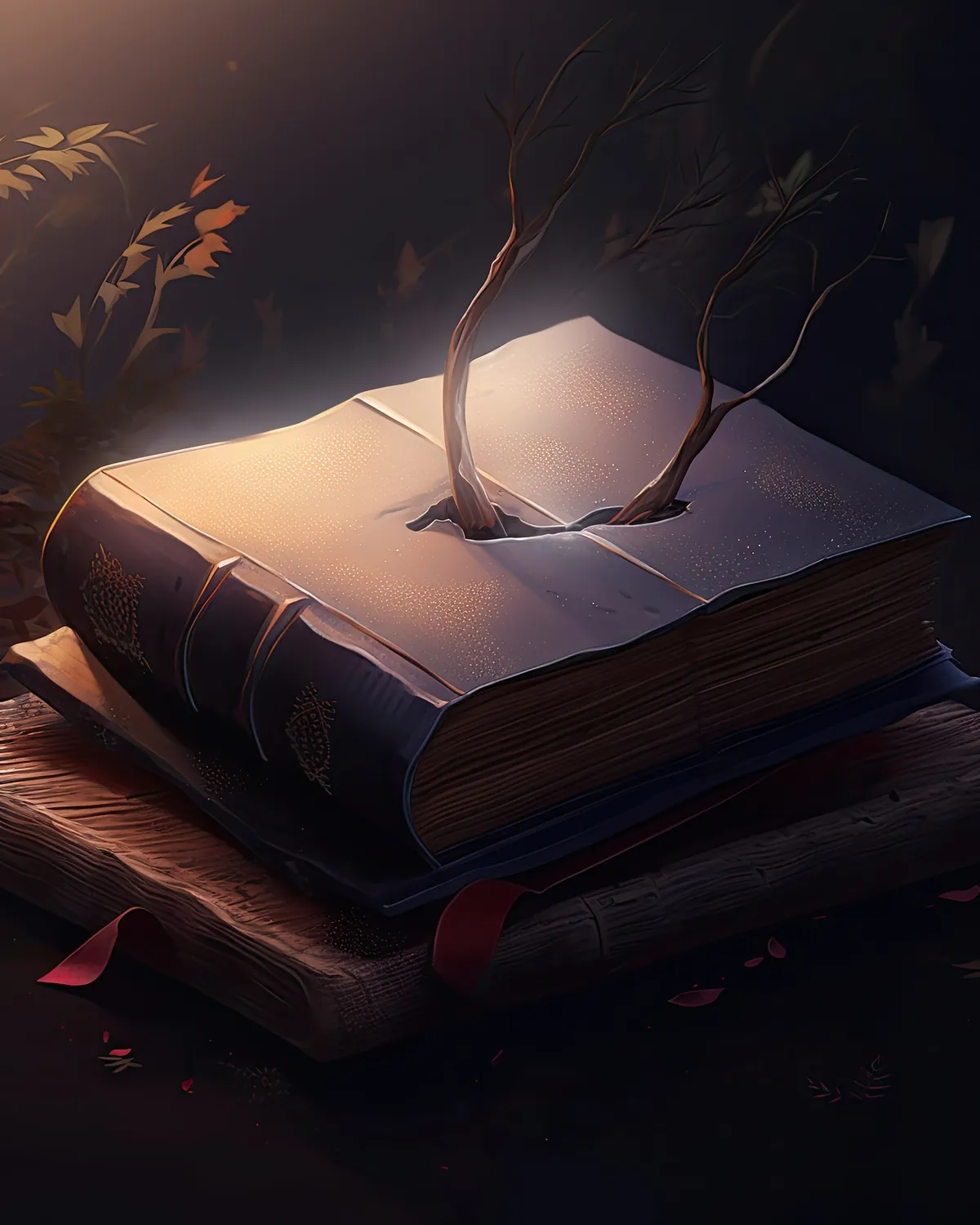Als ich am 24. April 2023 die Manuskript-Datei meines damaligen Romanprojekts schloss, war es das erste Mal, dass ich ein Buch aufgab. Die Geschichte meines gescheiterten Romans ist mir sicher eines Tages mal einen eigenen Blogpost wert, aber für mein nächstes abgeschlossenes Projekt, “Tod & Truzek”, ist er nur deshalb relevant, weil das Ende des Ersteren den Startpunkt des Letzteren bildet.
Denn natürlich fragte ich mich, was da monatelang so schiefgelaufen war. Wie ich so blind hatte sein können - und ob ich vielleicht gar nicht in der Lage war, mehr als ein Buch zu schreiben, mit dessen Qualität ich zufrieden war.
Schon nach Veröffentlichung von “Der Fall Zossner” unkte der ein oder andere Leser, das erste Buch sei sicher das Leichteste, und das zweite die wahre Herausforderung. Ich nahm das nicht sehr ernst, weil ich glaubte, die Erfahrung aus dem ersten Roman würde mir bestimmt eine große Hilfe sein - doch das Gegenteil war der Fall.
Was mich damals begeistert hatte, war, etwas Neues zu versuchen. Etwas Ambitioniertes, bei dem ich über mich hinauswachsen musste, Neues lernte und mich eingehend mit einem Thema beschäftigte.
All diese Eigenschaften ließ mein gescheitertes Projekt vermissen, und es dauerte einige Wochen, bis ich das Problem wirklich verstand. Geholfen hat mir dabei eine Frage, die ich mir seitdem bei allen Texten stelle, die ich auf eigene Faust verfasse (bei bezahlten Aufträgen stellt sie sich logischerweise nicht):
Warum muss
Ich erkannte bald, dass mein gescheiterter Roman keine Antwort auf die Frage “Warum jetzt?” hatte, und schloss daraus, dass das der Grund meines Misserfolgs gewesen sein musste.
Also stellte sich mir als Nächstes die Frage, wieso ich mich überhaupt auf so ein Projekt eingelassen hatte. Die Antwort, die ich fand, beschäftigte mich noch viele Wochen, und ich will einmal versuchen, sie so verständlich und knapp wie möglich darzulegen:
Man stelle sich einen Raum vor, in dem alle tatsächlichen und erdenklichen Bücher verortet werden können. Je nach Ähnlichkeit sind Bücher näher beieinander oder weiter voneinander entfernt.
Nun habe ich mit meinem ersten Roman einen einzigen Punkt innerhalb dieses Raums definiert, der mit mir als Autor assoziiert wird. Ein einzelner Punkt formt noch keine konkrete Erwartungshaltung, aber schon der zweite Punkt definiert eine Linie, die zwischen den beiden Roman verläuft. Nachfolgende Projekte können also daran gemessen werden, ob sie auf dieser Linie liegen oder von ihr abweichen. Es entsteht das Konzept von “typisch” und “untypisch” für den Autor. Mit einem dritten Projekt wird schließlich eine Fläche definiert, innerhalb derer die Romane die Erwartungshaltung der Leserschaft erfüllen, und außerhalb derer sie stattdessen enttäuscht (oder zumindest überrascht) wird. Ein vierter Punkt macht aus der Fläche eine nach außen geschlossene, dreidimensionale Form, die im Raum aller möglichen Bücher schwebt.
Der Fehler bei meinem zweiten Roman war es gewesen, den zweiten Punkt zu dicht am ersten zu wählen. Was ich also stattdessen tun musste, war, diesen zweiten Punkt so klug zu wählen, dass er einerseits der Bildung einer Form im Bücherraum dienlich war, die mir gefiel, mich andererseits aber nicht derartig einschränkte, dass mich das Schreiben vor lauter Gleichförmigkeit zu langweilen begann. Nach mehreren Wochen stand ein Konzept, das mich (hoffentlich) bis zum Ende meines Lebens begeistern wird und mir viele Freiheiten einräumt, die angestrebte Form aber nicht oder nur schleichend verändert.**
Außerdem besann ich mich darauf, mir wieder Ziele zu stecken, die mich forderten, statt das bereits Erlernte einfach nochmals anzuwenden. Im Falle von “Tod & Truzek” stellte ich mir folgende Aufgaben:
Eine erste Szene begann sich in meinem Kopf zu entwickeln, die auch in der Endfassung zu finden ist - in stark abgewandelter Form, aber der Kern ist noch da. Ohne den Inhalt zu verraten, sei doch so viel gesagt, dass es sich dabei um den Moment handelt, in dem alle Handlungsstränge zusammenlaufen.
Zu dieser Szene gesellte sich fragmentarisch eine zweite, die den Tiefpunkt aller Figuren darstellt, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird.
Es folgten Recherche und Planung, insbesondere bei der Verwebung der einzelnen Handlungsstränge. Mein Hauptziel war es, dass die beiden Urszenen ganz bestimmte Emotionen im Leser hervorrufen. Schließlich ist das Erfahren einer Geschichte eine emotionale Achterbahnfahrt, und da eine Achterbahn nicht von alleine fliegt, muss das Gerüst entsprechend solide geplant werden, wenn man die Emotionen der Fahrgäste nicht dem Zufall überlassen möchte.
So inspirierten sich Recherche, Figuren, gewünschte Emotionsentwicklungen und Planung fortwährend gegenseitig, bis ich schließlich mit einer hundert Folien starken PowerPoint-Präsentation alles akribisch durchgeplant hatte.
Außerdem sollten noch zwei weitere Dinge dieses Buch prägen, die mir anfangs große Mühe bereiteten, sich aber schlussendlich zu seinen größten Stärken und Besonderheiten entwickelten.
Der erste Umstand war die Tatsache, dass ich inzwischen zweifacher Vater war, dazu berufstätig mit einer Vollzeit berufstätigen Frau. Zeit zum Schreiben war also äußerst knapp.
Ich löste dieses Problem damit, dass ich die Kapitel ungewohnt kurz hielt - im Schnitt sind es nur etwas über 800 Worte pro Kapitel. Damit lohnte sich schon eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, um spürbare Fortschritte zu erzielen. Mein detaillierter Plan half mir, schnell wieder reinzufinden, auch wenn meine letzte Schreibgelegenheit schon einige Tage zurücklag. Der Effekt ist, dass sich die über 130 Kapitel recht zügig lesen und den “Binge Watching”-Effekt auslösen, den der ein oder andere vielleicht von Serien kennt: Es erscheint leichter, acht einstündige Folgen einer Serie zu schauen, als einen zweistündigen Film.
Der zweite Umstand war ein Trauerfall, der mich ungewohnt lange und fest im Griff hatte, und infolgedessen ich mich bei vielen kleinen und großen Entscheidungen abseits meiner Planung danach richtete, was dem Verstorbenen wohl die größere Freude gewesen wäre. Das hat dieses Buch zu einem ganz persönlichen Werk gemacht, das nicht mehr nur von meiner eigenen Persönlichkeit geprägt wurde, sondern zum ersten Mal bei einem Text von mir auch von der eines anderen.
Insbesondere dieser zweite Punkt machte aus dem Wunsch, dieses Buch zu schreiben, einen inneren Drang, dieses Buch schreiben zu müssen. Dabei geschah das in einer Lebensphase, in der das neben den Kindern auch durch Hauskauf und Kernsanierung schwieriger möglich war als je zuvor, und da ich ja außerdem noch meine Auftragsarbeiten hatte, kam es zwischendurch auch einmal zu einer fünfmonatigen Pause, in der bei aller Motivation wirklich überhaupt nichts mehr ging. Hatte ich “Der Fall Zossner” noch unter den bestmöglichen Bedingungen verfasst, so ist es nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt, dass ich “Tod & Truzek” unter den schlechtestmöglichen Bedingungen verfasst habe.Aber letztendlich schloss ich nach knapp anderthalb Jahren auch diesen Roman ab, und meine Befürchtung, nie wieder etwas in der Qualität von “Der Fall Zossner” schaffen zu können, war vollständig verflogen. Meine ursprünglich überschwängliche Euphorie, stattdessen sogar etwas noch Besseres geschaffen zu haben, hat sich inzwischen gelegt, und ich bin zu der Ansicht gelangt, dass die Bücher zu unterschiedlich sind, um sie zu vergleichen, ich aber hinter beiden mit viel Stolz voll und ganz stehen kann.
Damit ist nun auch die Entstehungsgeschichte von “Tod & Truzek” offengelegt, die euch Lesern ein hoffentlich tieferes Textverständnis und damit noch mehr Freude an dem Roman ermöglicht. Ich jedenfalls freue mich schon sehr darauf, dass in Lesungen vor Ort interessierten Zuhörern näher zu bringen und so ein Verständnis von Literatur zu fördern, dass sich selbstverständlich auch auf andere Romane übertragen lässt. Denn es gibt wenig, das mir mehr Freude bereitet als tiefes Textverständnis, und wenn ich mit meinen Werken und Erklärungen dem ein oder anderen den Weg dahin erleichtern kann, halte ich meine Rolle als Autor für durchaus nicht trivial.
*Auch diese Frage ist sicherlich irgendwann mal einen eigenen Blogpost wert.
** Dieses Konzept ist sicherlich mal einen Blogpost wert, wenn drei oder vier Romane von mir erschienen sind, damit ich es ausreichend in der Praxis verdeutlichen kann.